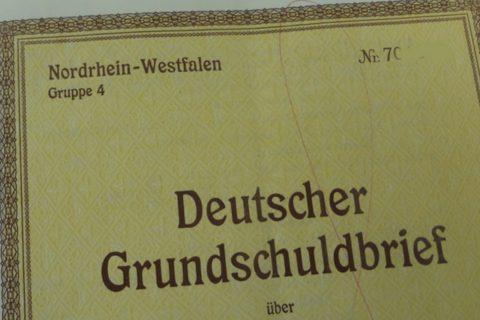Aktuell hatte sich der Bundesgerichtshof erneut1 mit den Anforderungen an die nötige Individualisierung des geltend gemachten prozessualen Anspruchs in einem Güteantrag in Anlageberatungsfällen zu befassen:

Der Güteantrag hat in Anlageberatungsfällen regelmäßig die konkrete Kapitalanlage zu bezeichnen, die Zeichnungssumme sowie den (ungefähren) Beratungszeitraum anzugeben und den Hergang der Beratung mindestens im Groben zu umreißen. Ferner ist das angestrebte Verfahrensziel zumindest soweit zu umschreiben, dass dem Gegner und der Gütestelle ein Rückschluss auf Art und Umfang der verfolgten Forderung möglich ist; eine genaue Bezifferung der Forderung muss der Güteantrag seiner Funktion gemäß demgegenüber grundsätzlich nicht enthalten2. Auch bedarf es für die Individualisierung nicht der Angabe von Einzelheiten, wie sie für die Substantiierung des anspruchsbegründenden Vorbringens erforderlich sind3.
Den vorgenannten Erfordernissen genügt der Güteantrag des Anlegers in dem hier entschiedenen Fall nicht. Er nennt zwar den Namen und die Anschrift des Anlegers (als „antragstellende Partei“), die Fondsgesellschaft, die Vertragsnummer und die Summe der Einlagen („56.242, 11 € zzgl. 5 % Agio“) sowie eine Reihe der geltend gemachten Beratungsmängel. Der Name des Beraters und der Zeitraum der Beratung und Zeichnung werden demgegenüber nicht erwähnt. Vor allem aber bleibt – und diesen Punkt sieht der Bundesgerichtshof hier als maßgeblich an – das angestrebte Verfahrensziel (Art und Umfang der Forderung) im Dunkeln. Im Güteantrag ist davon die Rede, dass die antragstellende Partei so zu stellen sei, als ob keine Beteiligung zustande gekommen wäre. Der geforderte Schadensersatz umfasse „sämtliche aufgebrachten Kapitalbeträge sowie entgangenen Gewinn und ggf. vorhandene sonstige Schäden (z.B. aus Darlehensfinanzierung oder Steuerrückzahlungen)“ sowie Rechtsanwaltskosten und „künftig noch aus der Beteiligung entstehende Schäden“. Dabei bleibt ausdrücklich offen („ggf.“), ob das eingebrachte Beteiligungskapital im vorliegenden Fall fremdfinanziert war, so dass ein etwaiger Schaden auch oder gar zu einem großen Teil in den aufgebrachten Zins- und Tilgungsleistungen bestanden hätte4. Auch die (hier nicht unerheblichen) weiteren Schäden (entgangener Gewinn und sonstige Schäden) sind nicht abschätzbar. Die Größenordnung des geltend gemachten Anspruchs ist für die Anlageberaterin (als Schuldnerin) und für die Gütestelle hiernach aus dem Güteantrag nicht zu erkennen und auch nicht wenigstens im Groben einzuschätzen gewesen.
Auch aus europarechtlichen Norme ergeben sich keine Vorgaben für die Anforderungen an die Individualisierung des in einem Güteantrag geltend gemachten (prozessualen) Anspruchs. Die Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.05.1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter5 betrifft den Verbrauchsgüterkauf (Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie) und somit nicht die Kapitalanlageberatung und enthält darüber hinaus auch keine Bestimmungen zum Inhalt eines Güteantrags. Den Anforderungen des Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.05.2013 über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG6 genügt § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB, wobei es offen bleiben kann, ob diese Richtlinie auf Gütestellen im Sinne des § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB überhaupt Anwendung findet. Vorgaben für den erforderlichen Inhalt eines Güteantrags ergeben sich aus Art. 12 Abs. 1 der genannten Richtlinie ohnehin nicht. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Artikel 267 AEUV ist entbehrlich. Die Erwägungen des Bundesgerichtshofs zum Europarecht ergeben sich ohne weiteres aus dem Wortlaut der zitierten Richtlinien, so dass die richtige Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig ist, dass für vernünftige Zweifel kein Raum mehr bleibt (acte clair)7.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 28. Januar 2016 – III ZB 88/15
- Bestätigung und Fortführung von BGH, Urteil vom 18.06.2015 – III ZR 198/14[↩]
- z.B. BGH, Urteile vom 18.06.2015 – III ZR 198/14, NJW 2015, 2407, 2409 Rn. 25 mwN; vom 20.08.2015 – III ZR 373/14, NJW 2015, 3297, 3298 Rn. 18; vom 03.09.2015 – III ZR 347/14, BeckRS 2015, 16019 Rn. 17; und vom 15.10.2015 – III ZR 170/14, WM 2015, 2181, 2182 Rn. 17; jew. mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 15.10.2015 aaO a.E.[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 20.08.2015 aaO S. 3299 Rn. 22; und vom 03.09.2015 aaO Rn. 18[↩]
- ABl. EG L 171/12[↩]
- ABl. EU L 165/63[↩]
- vgl. zB BGH, Urteile vom 06.11.2008 – III ZR 279/07, BGHZ 178, 243, 257 f Rn. 31; und vom 17.04.2014 – III ZR 87/13, BGHZ 201, 11, 22 Rn. 29; BGH, Beschluss vom 26.11.2007 – NotZ 23/07, BGHZ 174, 273, 287 Rn. 34[↩]